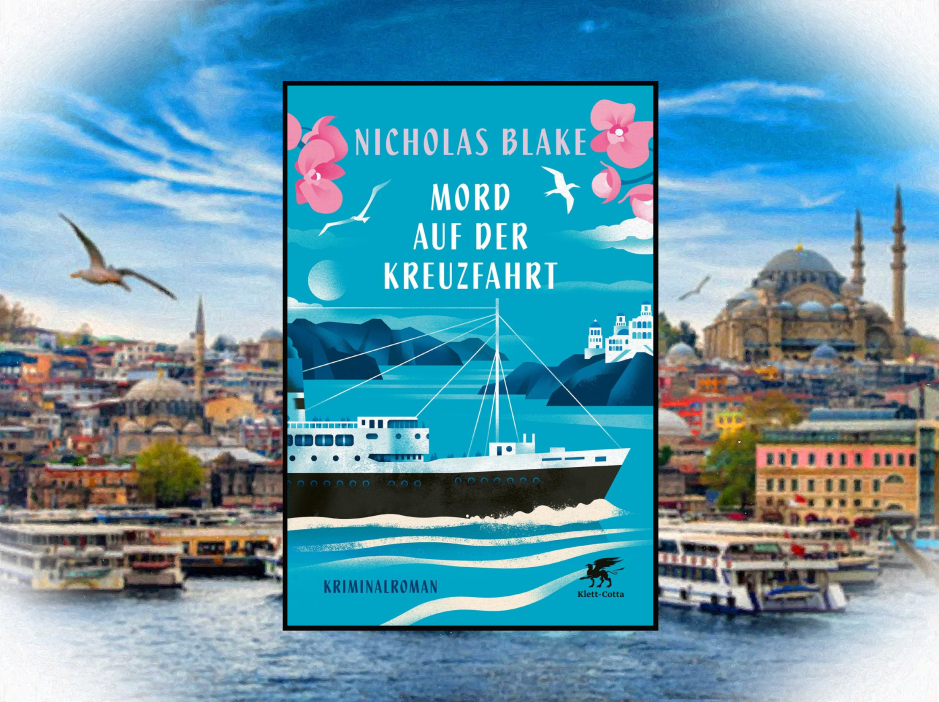Wer liebt es nicht, zu feiern?! Menschen kommen zusammen, essen und trinken, reden und lachen. Sie fühlen sich in der Gemeinschaft geborgen, und für wenige Stunden scheint die Zeit stillzustehen. Ja, sogar eine Ahnung von Friede ist wahrnehmbar. Doch welche Feste gibt es auf der Welt überhaupt? Da gibt es durchaus mannigfaltige Unterschiede. Doch allen ist das gemein, was ich eingangs schon beschrieben habe: Es geht um das gemeinsame friedvolle Erleben!
Wie feiert man den Frühling in Japan? Wann wird das jüdische Neujahrsfest zelebriert? Und was tragen Menschen zum Karneval in Venedig? In diesem Sammelband begeben wir uns auf eine Reise um die Welt. In informativen Texten begleitet von bunten Illustrationen werden Feste aus allen Jahreszeiten lehrreich vorgestellt, z. B. Chanukka, Halloween, Holi, Nouruz, Ramadan, Thanksgiving. Der viel gereisten Autorin Joanna Kończak gelingt es, 36 Feste kurzweilig zu beschreiben, und durch die kunstvollen Illustrationen von Ewa Poklewska-Kozietto erwachen sie zum Leben.
(Inhaltsangabe der Homepage des Verlages entnommen!)
Wie schon bei DIE SCHÖNSTE ZEIT. Weihnachten in aller Welt legt der NordSüd-Verlag auch diesmal wieder ein traumhaft schönes Bilder- und Lese-Buch vor, das einen wunderbaren Bogen spannt über Länder und Völker, über Religionen und Kulturen. Dabei stehen immer die verbindenden Elemente im Vordergrund. Das Kennenlernen der Unterschiede, die vielleicht auf dem ersten Blick uns trennen könnten, wird in diesem Buch deutlich als Gewinn betrachtet, da diese Andersartigkeit der Menschen das Leben auf unserer Erde so bunt, so spannend, so abwechslungsreich macht.
Doch warum sollte ich wissen, wie die Menschen anderer Kulturen feiern? Was geht es mich an? Wäre es nicht viel einfacher, wenn die Menschheit sich auf einige wenige Feste einigt, die dann überall und von allen gefeiert werden? Allein bei dem Gedanken treten Schweißperlen auf meine Stirn. Das wäre ja ungefähr so, als müssten wir uns alle identisch kleiden und dürften nur die gleichen Bücher lesen.
Dies wäre eine grauenvolle Vorstellung!
Darum: JA! Wir sollten es wissen. Denn erst ein Wissen schafft Respekt für ein friedvolles Miteinander und macht uns toleranter für andere Sicht- und Lebensweisen. Wie passend dieses Buch mir zur rechten Zeit in die Hände viel, zeigt folgendes Beispiel: Seit etlichen Jahren besuche ich ein und denselben Frisör-Salon und lasse mir dort von Murat meine Haare schneiden und den Bart stutzen. Die Tatsache, dass er Muslime ist und ich Christ bin, hat uns noch nie gestört. In der vergangenen Woche rief ich im Salon an, um bei ihm einen Termin zu vereinbaren, und erhielt die Auskunft, dass er frei hätte, da er das Zuckerfest feiert. Schnellstens griff ich zum Buch und wurde natürlich fündig. Das Fest des Fastenbrechens Eid al-Fidr, auch „Zuckerfest“ genannt, wird am Ende der Fastenzeit begangen. Die Fastenzeit soll daran erinnern, dass es auch viele Bedürftige auf der Welt gibt, die Unterstützung benötigen. Gerne wird auch an soziale Organisationen gespendet. Beim „Zuckerfest“ darf dann wieder geschlemmt werden: Die Menschen treffen sich mit Familie und Freunden und machen einander kleine Geschenke. Wie wunderbar, oder?
Ich bin nun ganz und gar nicht der Meinung, dass auch ich mir dieses Fest aneignen und zukünftig selbst feiern müsste. Ich habe meine eigenen traditionellen Feste, die auf meiner Kultur begründet sind. Doch ich würde mich durchaus freuen, wenn mich jemand mal zum „Zuckerfest“ einladen würde.
Die Texte von Joanna Kończak sind informativ, doch ebenso locker und leicht, positiv und absolut wertschätzend. Beim Lesen flog ich so mühelos über die Seiten, dass ich nahtlos von einem außergewöhnlichen Fest zum nächsten, ebenso außergewöhnlichen Fest wanderte. Ewa Poklewska-Kozietto hat abermals ganz prächtige Illustrationen geschaffen, die in ihrer Farbigkeit die Vielfalt feiert und eine immense Lebensfreude ausstrahlen. Gemeinsam haben sie ein so entzückendes Buch kreiert, das vielleicht nur einen kleinen aber dafür absolut herzerwärmenden Beitrag zur Völkerverständigung leistet. Denn…
…die Menschen sollten viel mehr miteinander feiern
als gegeneinander kämpfen!
💞