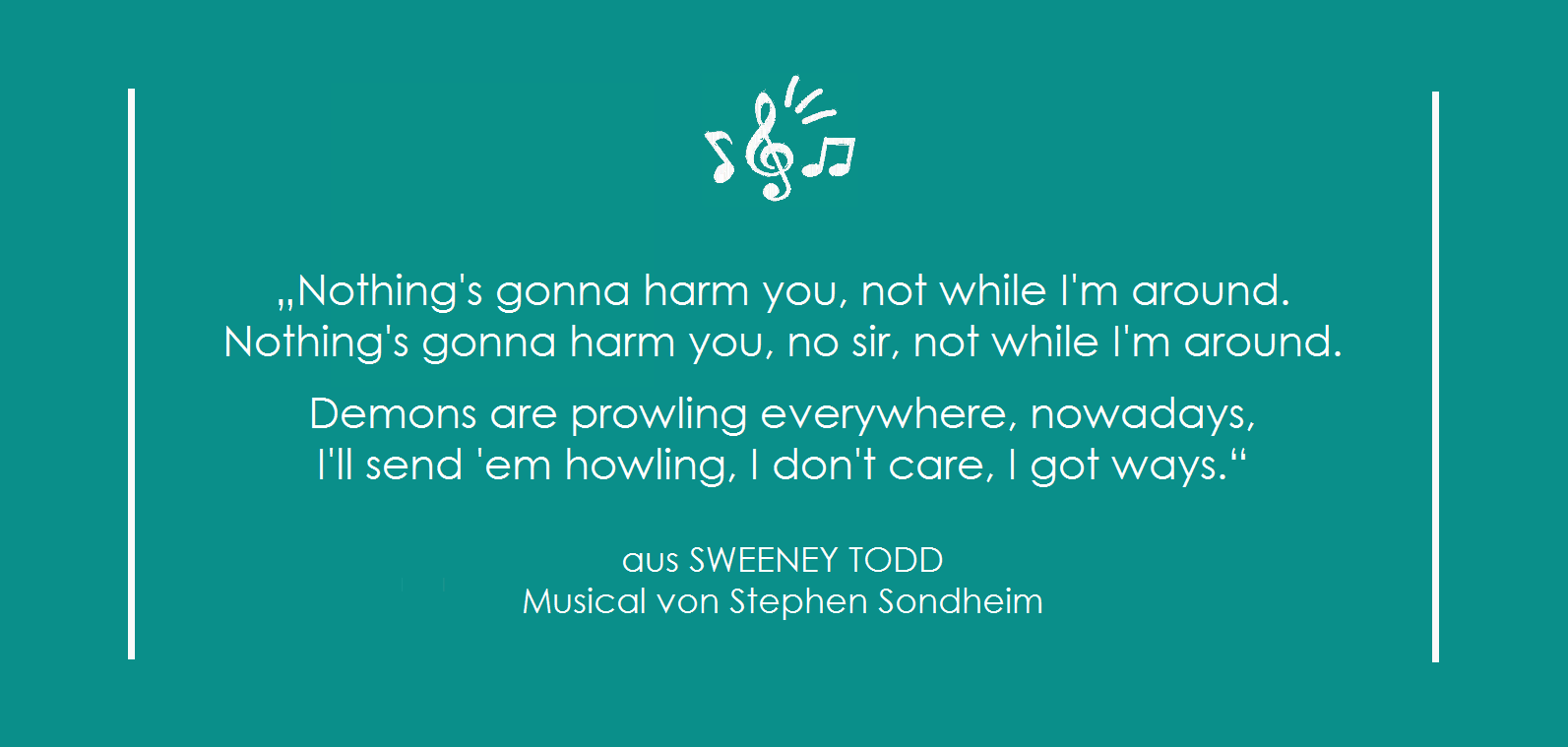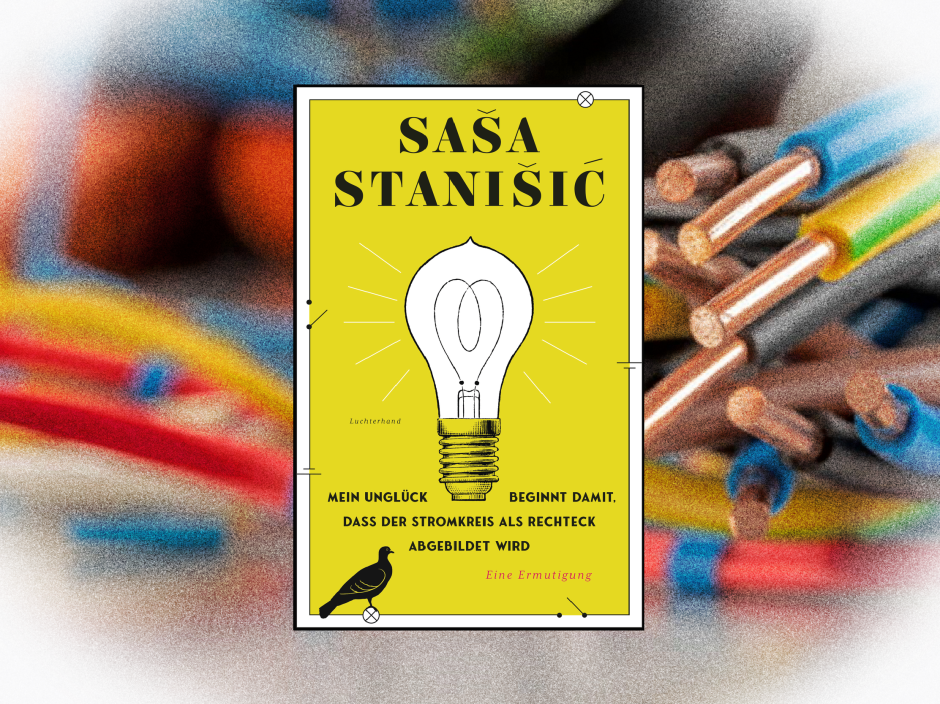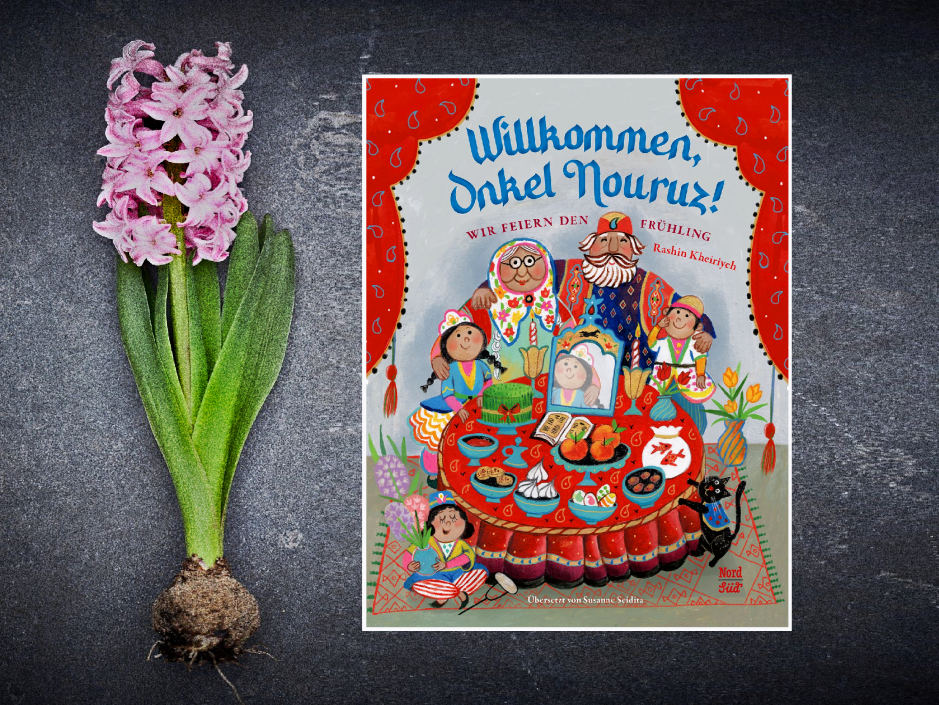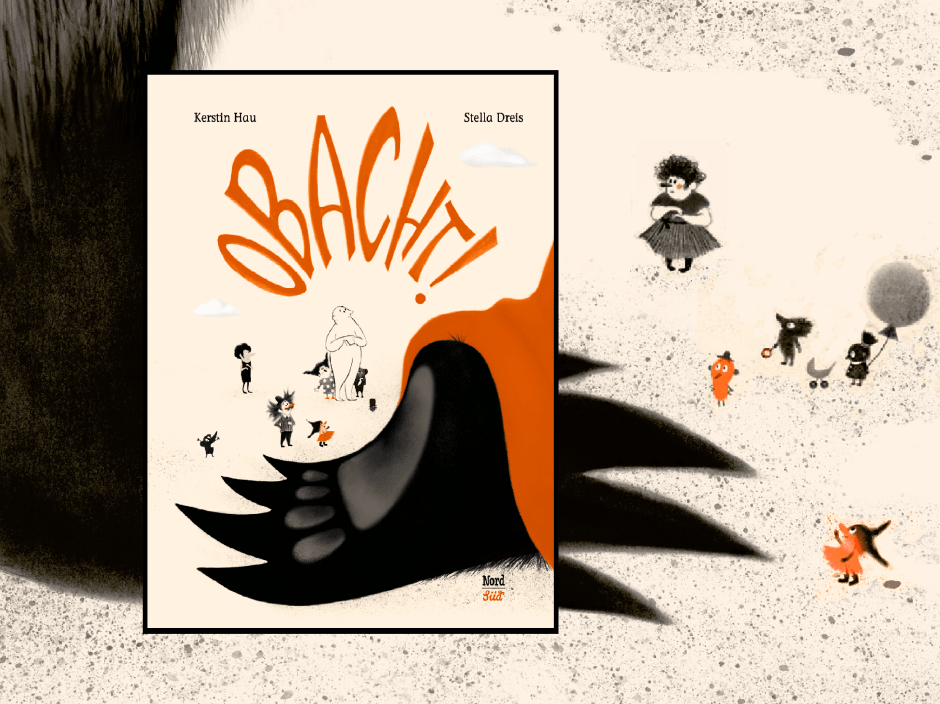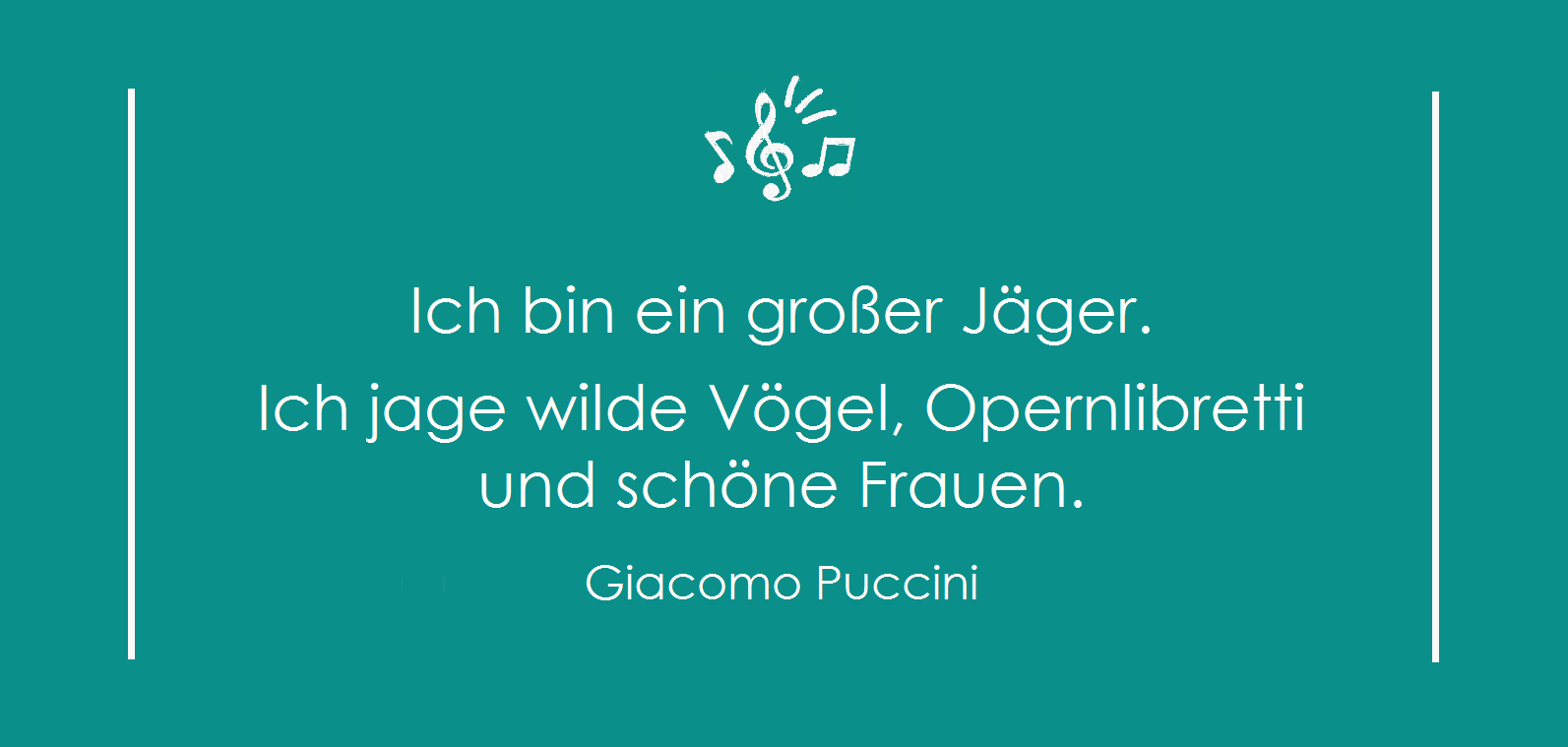
[Kolumne] OPER: …hat sie Schmerzen, oder warum schreit sie so laut?
Meine Süße meinte, sie wolle mal so echt krasses Zeug sehen. Da habe ich gleich alle Fast & Furious-Movies runtergeladen und mich total auf einen gemütlichen Abend auf dem Sofa gefreut. Doch das hatte sie nicht gemeint: Vielmehr hat sie von ihrer Tante zwei Karten für das Stadttheater geschenkt bekommen. Ihre Tante und ihr Onkel gehen da wohl regelmäßig hin, können sich die Termine aber nicht selbst aussuchen sondern bekommen die vom Theater vorgeschrieben. Das finde ich schon ziemlich dreist: Anstatt froh zu sein, dass überhaupt jemand kommt, diktiert das Theater, wann man zu erscheinen hat. Die tun ja so, als wären sie irgend so ’n elitärer Verein, wo man froh sein kann, dass sie für unsereins die Tore öffnen. Da ist es absolut logisch, dass nicht alle immer Zeit haben, und so ist meine Süße eben zu den Karten gekommen. Ich hatte mich aber so über die Arroganz der Theaterheinis geärgert, dass ich ganz vergessen hatte zu fragen, was wir uns da nun ansehen werden.
OPER heißt das Zeug, was dort gezeigt werden sollte.
Naja, zum Glück bin ich ja ein ganz lockerer Typ und für alles offen. Also sind wir hin! Zugegeben der Bau sah schon beindruckend düster aus – fast so wie aus einem der alten Vampir-Filme. Doch leider verpuffte der positive Eindruck direkt nach Betreten der heiligen Hallen. Ist es zu glauben? Wir durften doch tatsächlich unsere Jacken nicht mit in den Zuschauersaal nehmen, sondern wurden genötigt, sie an der Garderobe abzugeben, wofür frecherweise auch noch eine Gebühr verlangt wurde. Als ich dann zähneknirschend zahlen wollte und einen 50 Euro-Schein aus der Geldbörse fingerte, konnte dieser noch nicht einmal gewechselt werden. Unglaublich: Servicewüste Deutschland!
Doch es kam noch besser! Im Saal wurde verlangt, dass ich mein Handy stumm-, besser noch ausschalte: Geht gar nicht! Wer macht den sowas? Was ist, wenn mein Bro was von mir will? Könnte doch wichtig sein! Und als ich dann mit meiner Süßen noch ein wenig quatschen wollte, wurde ich von der Seite angemacht, dass ich die Vorstellung stören würde. Dabei hatte die Vorstellung noch gar nicht angefangen, sondern da dudelte nur irgendeine Musik aus dieser komischen Vertiefung vor der Bühne. Die war zudem total ungesichert. Voll gefährlich sowas, wenn da mal einer reinfällt, das zahlt keine Versicherung.
Aber die schienen dort sowieso alle die totalen Snobs zu sein: Rennen mitten in der Woche mit Anzug und Blink-Blink-Bluse rum. Wollten die hinterher noch irgendwo zum Staatsbegräbnis? Naja, wenigsten wir hatten die total hippen Outfits, da konnten diese Grufties sich mal was abgucken: Meine Süße trug u.a. ein sexy bauchfreies Top, und ich hatte meine beste Baggy-Jeans an, die absolut cool auf der Hüfte saß.
Dann ist da in der Vertiefung irgend so ’n Macker aufgetaucht (Ich sah seinen Schädel über den Rand blitzen.), und die anderen Heinis im Saal klatschten in die Hände. Wozu? Der Alte hatte doch noch gar nichts gemacht. Hatten die da ’ne Fliegenplage, mussten Insekten verscheucht werden, oder warum wedelte der Macker jetzt mit ’nem Stock in der Luft rum. Das machte er während der gesamten Vorstellung: Vielleicht sollte ich dem Gesundheitsamt mal ’nen Tipp geben. Wer weiß schon, was in diesem alten Kasten so alles verwest und das Ungeziefer anlockt.
Dann ging der Vorhang auf, und etliche Typen in Verkleidung latschten auf die Bühne und fingen an, sich gegenseitig in irgendeiner unbekannten Sprache anzubrüllen. Die Heuler mit den dunkleren Stimmen gingen ja noch, aber einige von den verkleideten Tussis kreischten so gellend laut, dass meine Trommelfelle vibrierten und das Eis in meiner Coke klirrte. Wir waren zum Glück vorher noch bei Mäckes und hatten uns mit Getränken eingedeckt. Aber auch Getränke schienen hier unerwünscht zu sein, zumindest mitgebrachte. Da tippte mir doch so ’ne Schachtel von hinten auf die Schulter und meinte ernsthaft, ich solle nicht so laut an meinem Trinkhalm saugen, sie würde von vorne nichts verstehen. Hallo?! Die brüllten da vorne so laut, wenn sie davon nichts verstand, schien sie wohl schwerhörig zu sein. Abgesehen davon, dass von dem Kauderwelsch, das die da auf der Bühne schwafelten, sowieso nichts zu verstehen war. Da halfen auch nicht die eingeblendeten Botschaften über der Bühne. Jeder anständige Film hat UNTERtitel: Schont den Nacken und entlastet die Augen. Und was gibt’s in diesem selbsternannten Kulturtempel? ÜBERtitel! Voll unbequem! Die scheinen hier ihre Kundschaft echt nicht zu mögen.
Auf der Bühne wurd’s immer merkwürdiger. Da lag einer mit einem Messer im Rücken auf dem Boden und sang sich die Seele aus dem Leib. Wie unrealistisch: Würde mir einer ein Messer in den Rücken rammen, würde ich brüllen wie am Spieß aber sicher nicht irgendwelche Arien trällern:
„Ich ster-her-be! Schaut her: Ich ster-her-be!“
Und auch die Kampfszene, die die davor gezeigt haben, hätten sie ruhig etwas aufmotzen können. Drei Mal sind sie um so’n blöden Tisch gerannt (Sollte wohl eine Verfolgungsszene sein.), der eine hat unmotiviert mit einem Messer gewedelt, und der andere hätte locker entkommen können, ließ sich aber einholen und erstechen. Das hätte man alles mit mehr Action machen können, aber für professionelle Stunt-Doubles hat’s wohl nicht gereicht.
Dann haben sie auch erst nach satten 2 Stunden ’ne Pause (Keramikabteilung: Ich komme!) gemacht, nur um danach noch beinah 1½ Stunden weiter zu grölen. Ich hatte bereits in der Pause von der ganzen Chose die Schnauze gestrichen voll und wäre gerne verduftet, doch meine Süße meinte, ihre Tante würde bestimmt nachhaken, wie’s uns so gefallen hätte und so. Dabei hätte man die Story locker auf 45 Minuten kürzen können. Bei GZSZ passiert in knapp 25 Minuten genauso viel wie hier in einer halben Ewigkeit – und zusätzlich macht dort ein Cliffhanger neugierig auf die nächste Folge.
Und hier? Alle tot! Tot, Aus und Ende! Da kommt nichts mehr nach!
Na, meine Lust auf einen weiteren Besuch in diesem Bau war zumindest erloschen. Dann doch lieber alle Fast & Furious-Movies am Stück. Allerdings war meine Süße da ganz anderer Meinung: Nach der Vorstellung stand sie ziemlich ramponiert vor mir, flennte in ihren Ärmel (die Taschentücher waren noch in ihrer Jacke an der Garderobe) und seufzte „Das war so schön! Das machen wir unbedingt nochmal!“. Wenn sie sich was in den Kopf setzt, dann ist Widerspruch zwecklos.
Was tut man(n) nicht alles aus Liebe! 💞
LI·TE·RA·RISCHE HEL·DEN…
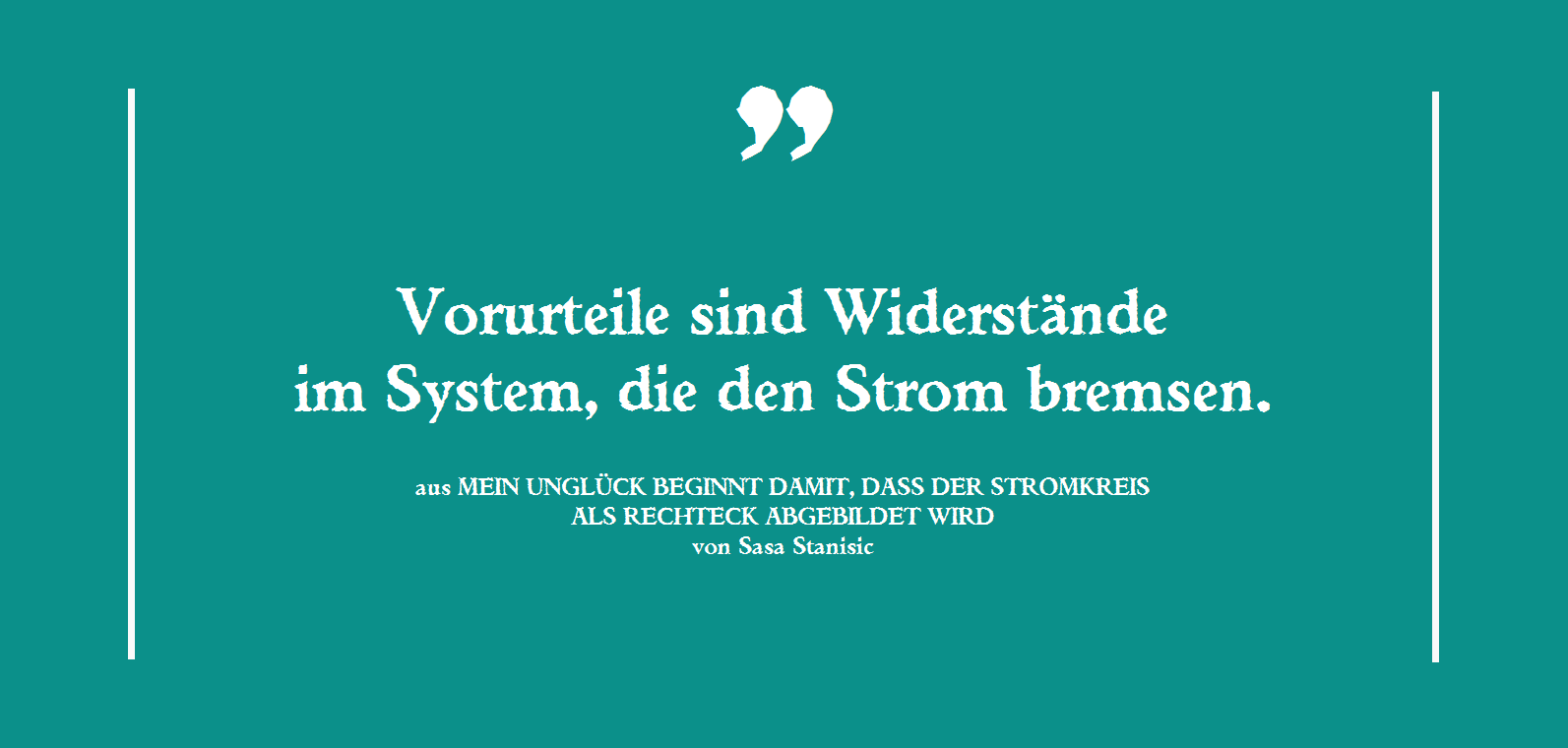
[Rezension] Saša Stanišić – MEIN UNGLÜCK BEGINNT DAMIT, DASS DER STROMKREIS ALS RECHTECK ABGEBILDET WIRD. Eine Ermutigung
Ich las den Titel und dachte so bei mir „Stimmt! Warum wird eigentlich ein StromKREIS als RECHTECK dargestellt?“. Da hatte ich im jugendlichen Alter jahrelang den von mir so verhassten Physik-Unterricht beim Lehrer Herrn Tute (Er hieß tatsächlich so!), habe Schaltkreis über Schaltkreis mit dem Geodreieck fein säuberlich rechteckig auf das Papier gepinselt, und nie fiel mir dieser Widerspruch auf. Schade! Nur allzu gerne wüsste ich, welche Begründung Herr Tute dafür parat gehabt hätte.
Insgesamt neun Reden sind in diesem 160 Seiten umfassenden Büchlein versammelt. Acht Reden hat Saša Stanišić tatsächlich bei div. Veranstaltungen (u.a. Verleihung von Literaturpreisen, Vorlesung an einer Hochschule, Preisgala, Eröffnung eines Literaturhauses) bereits öffentlich vorgetragen. Bei einer der hier vereinten Reden hatte er bisher noch keine Gelegenheit, sie öffentlich – vorzugsweise in Graz – halten zu dürfen. Aber da sollte sich doch eine passende Gelegenheit finden, zumal – wie er betont – ihm der Anlass egal wäre.
So sind diese Reden natürlich sehr mit dem jeweiligen Kontext verbunden. Ist deren Inhalt dann trotzdem für Uneingeweihte nachvollziehbar und verständlich? Ja, er ist es, denn Stanišić spricht im Rahmen der jeweiligen Reden Themen an, die universell verstanden werden können. Dies macht er in seiner unnachahmlichen Art, persönliches Erleben und individuell Wahrgenommenes mit Humor einzurahmen. Da nimmt er – insbesondere wenn er aus seiner eigenen Biografie berichtet – der Tragik das allzu Schwere, ohne die Relevanz zu verwässern. Und genau dieser lakonische Ton, der gänzlich auf Mitleid verzichtet, traf mich umso intensiver ins Herz.
Saša Stanišić sieht sich als Pate für all die schwachen und verletzten Seelen und leiht den Sprachlosen seine Stimme. Stimme, Sprache, Verständigung – nur darüber kann Integration funktionieren.
Denn, wenn der Stromkreis der Veränderung unterbrochen ist, kann die Glühbirne der Weiterentwicklung nicht strahlen. So fordert er insbesondere bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, sie sensibel an die deutsche Sprache heranzuführen und deren Liebe zu Wörtern und Geschichten zu fördern. Er bindet eigene Erlebnisse in seine Reden ein, die dadurch an Fülle gewinnen und mich umso mehr berührten. Da verlassen die Wörter das Schematische der Rede und formen sich zu einer Erzählung, die lebendig und unterhaltsam ist, da der Autor eine Vielzahl an Bildern in meinem Kopf entstehen ließ.
Seine Reden sind voller Leben und voller Weisheit. Sie nähren sich aus seinen Erfahrungen und seinen Erinnerungen. Er fordert uns auf nachzudenken, zu prüfen und zu hinterfragen. Denn jeder von uns trägt den Mut und die Kraft in sich, die Welt ein klein wenig besser zu machen.
erschienen bei Luchterhand / ISBN: 978-3630878409
Ich danke dem Verlag herzlich für das zur Verfügung gestellte Leseexemplar!
[Rezension] Rashin Kheiriyeh – WILLKOMMEN, ONKEL NOURUZ! WIR FEIERN DEN FRÜHLING
Frühling! – Ich bin so sehr reif für ihn! Nach Schnee, Glätte und Kälte sehne ich mich so sehr nach den ersten Sonnenstrahlen, die mit einem Hauch von Wärme auf meiner Haut kitzeln. Ich begrüße es so sehr, dass die Tage zwar langsam aber doch durchaus spürbar länger werden.
Licht! Ich brauche Licht so sehr! Und Farben! Licht und Farben!
Jedes Jahr wartet Naneh Sarma auf ihren alten Freund Onkel Nouruz. Unglücklicherweise verpasst sie ihn jedes Mal! Das ist schade, kündigt Onkel Nouruz doch den Frühling an. Zu seinen Ehren bereitet sie ihm ein rauschendes Fest. Gemeinsam mit ihren Enkelkindern wird das Haus gründlich geputzt, und es wird festlich aufgetischt. Wenn der Onkel eintrifft, döst Naneh Sarma aber bereits – wie jedes Jahr.
(Inhaltsangabe der Homepage des Verlages entnommen!)

„Mit Nouruz, was „neuer Tag“ bedeutet, beginnt sowohl das persische Neujahr als auch der Frühling. Seit mehr als 3.000 Jahren wird das Fest im Iran, in Zentralasien und auch jenseits davon gefeiert und ist eine sehr symbolträchtige Zeit der Freude – ein Fest der Erneuerung, Wiedergeburt und Hoffnung.“
…beginnt Rashin Kheiriyeh das Nachwort zu ihrem Bilderbuch, das mich mit seiner Farbigkeit belebte und erfrischend wie ein Frühlingswind auf mich wirkte. Ihre Illustrationen erscheinen, als hätte die Künstlerin zur Realisation Filzstifte wie auch Wachsmalstifte verwendet, und genauso abwechslungsreich die Farben in ihrem Stiftköcher waren, so bunt erstrahlen auch diese Bilder. Da leuchten die Farben mit aller Kraft und vertreiben mit ihrer Vitalität das Trübe und das Düstere. Beim Betrachten der Bilder bekam ich unweigerlich gute Laune, zumal Rashin Kheiriyeh so wunderbar mit Formen und Mustern spielte und ihre Figuren so warmherzig porträtierte.
Nouruz ist „ein Fest der Erneuerung, Wiedergeburt und Hoffnung“, aber es steht für mich auch für Gemeinschaft, Freundschaft und Gastlichkeit. Zusammenhalt: Wir Menschen brauchen in dieser momentan heraufordernden Zeit das Gefühl, dass wir zusammenhalten – im besten Sinne des Wortes. Gemeinsam Feste feiern könnte da helfen – unabhängig von Herkunft und Glaube, über Länder und Grenzen aber vor allem auch über dem eigenen Gartenzaun hinweg.
„Wer Bücher liest schaut in die Welt und nicht nur bis zum Zaune.“ sagte einst Johann Wolfgang von Goethe so weise. Und insbesondere so wertvolle Bilderbücher wie WILLKOMMEN, ONKEL NOURUZ! WIR FEIERN DEN FRÜHLING ermöglichen es den Kindern sich spielerisch auf eine phantasievolle Reise zu begeben, um unbekannte Kulturen besser kennenzulernen und so die inneren Hürden zu überwinden.
In Rashin Kheiriyehs Geschichte steckt Onkel Nouruz der schlafenden Naneh Sarma zärtlich eine Hyazinthe ins weiße Haar, als stände dies sinnbildlich für die ersten Frühlingsblüher, die ihre zarten Knospen durch die Schneedecke recken. Und in mir erwachte das Bedürfnis, auch mein Heim mit Narzissen, Tulpen und natürlich vielen Hyazinthen zu schmücken, um so vielleicht den Zauber des Frühlings in mein Haus zu locken.
Frühling! – Sei mir willkommen!
erschienen bei NordSüd / ISBN: 978-3314107610 / in der Übersetzung von Susanne Seidita
Ich danke dem Verlag herzlich für das zur Verfügung gestellte Leseexemplar!
[Ausstellung] ERINNERN HEISST KÄMPFEN! Zwischen Anerkennung und Vergessen / Rathaus Osterholz-Scharmbeck
Dauer der Ausstellung: 10. bis 20. Februar 2026 / Besuch: 13. Februar 2026
Unteres Foyer/ Rathaus in Osterholz-Scharmbeck
Das staunte ich nicht schlecht, als ich morgens am Tag meines Besuchs der Ausstellung die Rollläden vor den Fenstern lupfte, und die Welt wieder im satten Weiß erstrahlte. Kurz war ich mit mir uneins, ob ich das regnerische Grau der letzten Tage oder das heutige Weiß besser finden sollte. Rein aus ästhetischen Gründen favorisierte ich dann doch eher den nass-kalten Schnee, der den Schmutz der letzten Tage gnädig bedeckte.
Was allerdings niemals „bedeckt“ und somit verschwiegen werden sollte, sind die Gewalt-Taten, die durch Täter mit rechtsextremer Gesinnung verübt wurden. Die Wanderausstellung ERINNERN HEISST KÄMPFEN! setzt ein Zeichen der Aufklärung. Sie entstand unter der Ägide von Mobile Beratung Niedersachsen gegen Rechtextremismus für Demokratie und wurde organisiert von OMAS GEGEN RECHTS OHZ in Zusammenarbeit mit dem Bündnis für Demokratie OHZ.
Die Ausstellung umfasst 25 Schautafeln, die höchst informativ einen Überblick schaffen, u.a. was unter „rechte Gewalt“ verstanden werden kann, und wie sie im gesellschaftlichen Kontext zu sehen ist. Dabei musste ich ernüchternd erfahren, dass dies kein Phänomen der jüngeren Vergangenheit ist. Vielmehr gab es bereits in den 90er Jahren entsprechend rechtsextremistische Vorkommnisse, die aber ängstlich nicht als solche erkannt bzw. benannt wurden. Gemäß dem Zitat von Christian Morgenstern „Weil nicht sein kann, was nicht sein darf.“ wurden die Augen vor der drohenden Ausbreitung verschlossen bzw. diese verharmlost.
Doch im Mittelpunkt der Ausstellung stehen exemplarisch 10 Schicksale von Menschen, die rechter Gewalt ausgesetzt waren und oft durch sie auch getötet wurden. Dabei wurden viele dieser Taten nicht von Polizei und Justiz als rechts eingestuft, obwohl es oft deutliche Anzeichen gab. Da stellte ich mir mit Schrecken die Frage „Wie hoch ist da wohl die Dunkelziffer?“. Alle Betroffenen waren keine Zufalls-Opfer, sondern wurden von den Tätern bewusst ausgewählt, da sie aufgrund ihrer Überzeugung, ihrer Herkunft oder ihrer Lebensumstände vom rechten Pöbel als „unwertes Leben“ angesehen wurden. Wie tief muss der Schmerz bei den Familien und Freunden der Opfer sitzen: Sie hatten nicht nur einen geliebten Menschen verloren, sondern auch die wahren Hintergründe zur Tat wurden nicht anerkannt.
Umso wichtiger ist es, dass wir Orte und Formen der Erinnerung schaffen: Die Ausstellung schließt mit einigen Beispielen. Einerseits sind wir es den Opfern – den bekannten wie auch den vielen unbekannten – schuldig, sie vor dem Vergessen zu bewahren, andererseits müssen wir sorgen, dass rechtes Gedankengut nicht als Bagatelle, als Normalität angesehen wird. Der Rechtsextremismus mit seiner menschenverachtenden Ideologie ist eine Gefahr für unsere Demokratie, eine Gefahr für Solidarität und Menschlichkeit.
Die Ausstellung ERINNERN HEISST KÄMPFEN! fordert ihre Besucher heraus, sowohl aufgrund der Relevanz des Themas, als auch bezüglich der Fülle an Text. Diese Fülle sollte aber bitte niemanden abschrecken, den Text auf den Schautafeln vor Ort zu lesen. Ich habe vielmehr die Erfahrung gemacht, dass ich – hatte ich erstmal den Einstieg in den Text gefunden – mich schnell „festgelesen“ hatte. Zudem erhält man vor Ort einen tollen Ausstellungkatalog, in dem alle Informationen nochmals nachgelesen werden können.
Viele Informationen mit Nennung der weiteren Stationen der Ausstellung findet ihr auf der Homepage ERINNERN HEISST KÄMPFEN!.
[Rezension] Vera Conny Jack – ACHT (UN)GEPLANTE TAGE MIT DIR
Ich habe bisher immer einen großen Bogen um Bücher gemacht, die aus der Feder von Menschen stammen, die mir persönlich bekannt sind. Damit meine ich nicht den eher oberflächlichen Kontakt, den man zu Autor*innen während einer Lesung hat. Ich meine eher Menschen, die ich in einem ganz anderen Zusammenhang kennengelernt habe, und die (rein zufällig) irgendwann ein Buch geschrieben und veröffentlicht haben. Da hoffe ich jedes Mal, dass von mir nicht erwartet wird, dieses Buch zu lesen und eine Rezension darüber zu verfassen. Denn wie verhalte ich mich, wenn mir besagtes Buch nicht gefallen sollte? Diplomatisches aber ängstliches Drumherum-Reden oder ehrliche und respektvolle Meinungsäußerung? Schließlich möchte ich die Gefühle der mir bekannten Person nicht verletzten. Versteht ihr nun, in welchem Dilemma ich stecke?
Doch warum habe ich nun eine Ausnahme gemacht? In diesem Fall handelt es sich um das Erstlingswerk meiner geschätzten Blogger-Kollegin Vera Conny Jack. Seit einer gefühlten Ewigkeit sorgen wir beide – gemeinsam mit zwei lieben Blogger-Kolleginnen – auf Instagram für die Themenauswahl am s.g. Challenge-Montag unter dem Hashtag #4x(+Name des Themas). Vera hätte mich nie in das eingangs beschriebene Dilemma hineinmanövriert, da wir ziemlich genau voneinander wissen, wer welche Genres gerne liest. So hat Vera höchstwahrscheinlich auch nie mit meinem Interesse an ihren Roman gerechnet. Doch dann dachte ich mir, dass Veras Werk vielleicht genau die richtige Lektüre ist, die mein Krimi-geschundenes Herz für Liebesromane erweichen könnte.
Also: „Here we go!“
Sie lässt sich gern treiben. Er plant jedes Detail. Vor ihnen liegen acht Tage New York. Übersetzerin Hazel darf für ihre beste Freundin eine gewonnene Reise nach New York antreten. Der Haken daran? Ihr Travelbuddy ist deren etwas nerdiger Bruder. Lukas ist nicht nur gar nicht ihr Typ, sondern zu allem Übel extrem durchgeplant, während Hazel gern die Atmosphäre vom Big Apple aufsaugen möchte. Was als Zweckgemeinschaft beginnt, wird zu einer wunderschönen Zeit in der Stadt, die niemals schläft. Sie kommen sich näher, dabei bleiben ihnen nur diese acht Tage. Und so schließen sie einen ungewöhnlichen Deal: Ein Time-out von ihren Leben…
(Inhaltsangabe der Homepage des Verlages entnommen!)
Okay, dass ich euch ausgerechnet am heutigen Valentinstag einen Liebesroman präsentiere, passiert natürlich nicht von ungefähr: Sehr bewusst habe ich diesen speziellen Tag für die Präsentation meiner Rezension gewählt. Dabei musste ich mich schon sehr zügeln, dass ich diesen Roman nicht früher rezensiere, zumal Vera ihn mir bereits im letzten Jahr direkt nach der Frankfurter Buchmesse zugeschickt hatte. Doch schnell war mir klar, dass ich euch diesen Roman – trotz meiner persönlichen Neugier – als Valentin-Schmankerl offerieren möchte.
Und so tauchte ich ein in eine literarische Welt, die sich mir bisher eher höchst selten erschlossen hatte, da sie nicht zu meinem präferierten Roman-Genre passt. Der Stil des Romans erinnerte mich an eine dieser wunderbaren, atmosphärisch dichten Romantik-Filme, wo das Flair einer Stadt nicht nur als Kulisse fungiert, sondern vielmehr eine wesentliche Hauptrolle spielt. So ist auch in dieser luftig-leichten Romanze Veras Liebe zu New York deutlich spürbar. Ihre Beschreibung dieser Stadt war so detailreich. Ich gewann den Eindruck, dass ich mich auf den Spuren von Hazel und Lukas begeben könnte, und würde die erwähnten Schauplätze eins zu eins in der Realität wiederfinden. Dabei belässt Vera es nicht bei einem simplen Sightseeing, sondern erlaubt ihren Figuren auch eine verständliche Emotionalität beim Besuch der Orte, wo das Schicksal tiefe Wunden in die Seele der Stadt gerissen hat.
Tagebuchartig lässt die Autorin mal die Heldin, mal den Helden zu Wort kommen. So schauen wir abwechselnd aus dem jeweiligen Blickwinkel von Hazel bzw. Lukas auf ihre „(un)geplanten Tage“ im Big Apple und erfahren so die sehr individuellen Eindrücke zu den gemeinsam erlebten Situationen. Dabei gelingt es Vera, den Charakter dieser Berichte den Persönlichkeiten der Beiden anzupassen. Der Lesende wird somit zum allwissenden Verbündeten, der beinah, wie mit seherischen Fähigkeiten ausgestattet, kommende Komplikationen erahnen kann. Da darf natürlich auch ein Hauch Erotik nicht fehlen, den Vera durchaus prickelnd doch äußerst geschmackvoll beschreibt.
Glücklicherweise vermeidet Vera es, entbehrliche wie unglaubwürdige Irrungen und Wirrungen in die Handlung einzubauen, die nur den Zweck erfüllen würden, künstlich Drama zu erzeugen und zusätzliche Masse ergo Seiten zu generieren. Somit konnte ich mich gänzlich auf die sich anbahnende Romanze, die sich schlussendlich als klassische „Boy meets girl, boy loses girl, boy gets girl back“-Story entpuppte, konzentrieren und nebenher ein wenig am reichhaltigen Bouquet der Welt-Metropole New York schnuppern.
Nein, auch diese Lektüre konnte mein Krimi-geschundenes bzw. (vielmehr) mein Krimi-liebendes Herz nicht für Liebesromane erweicht, aber es war eine charmante Abwechslung zu den vielen Schurken, Halunken und Gesetzesbrechern, die mir sonst zahlreich zwischen zwei Buchdeckeln über den Weg laufen.
erschienen bei Flamingo Tales / ISBN: 978-3989425118
APHO·RI·SI·A·KUM…
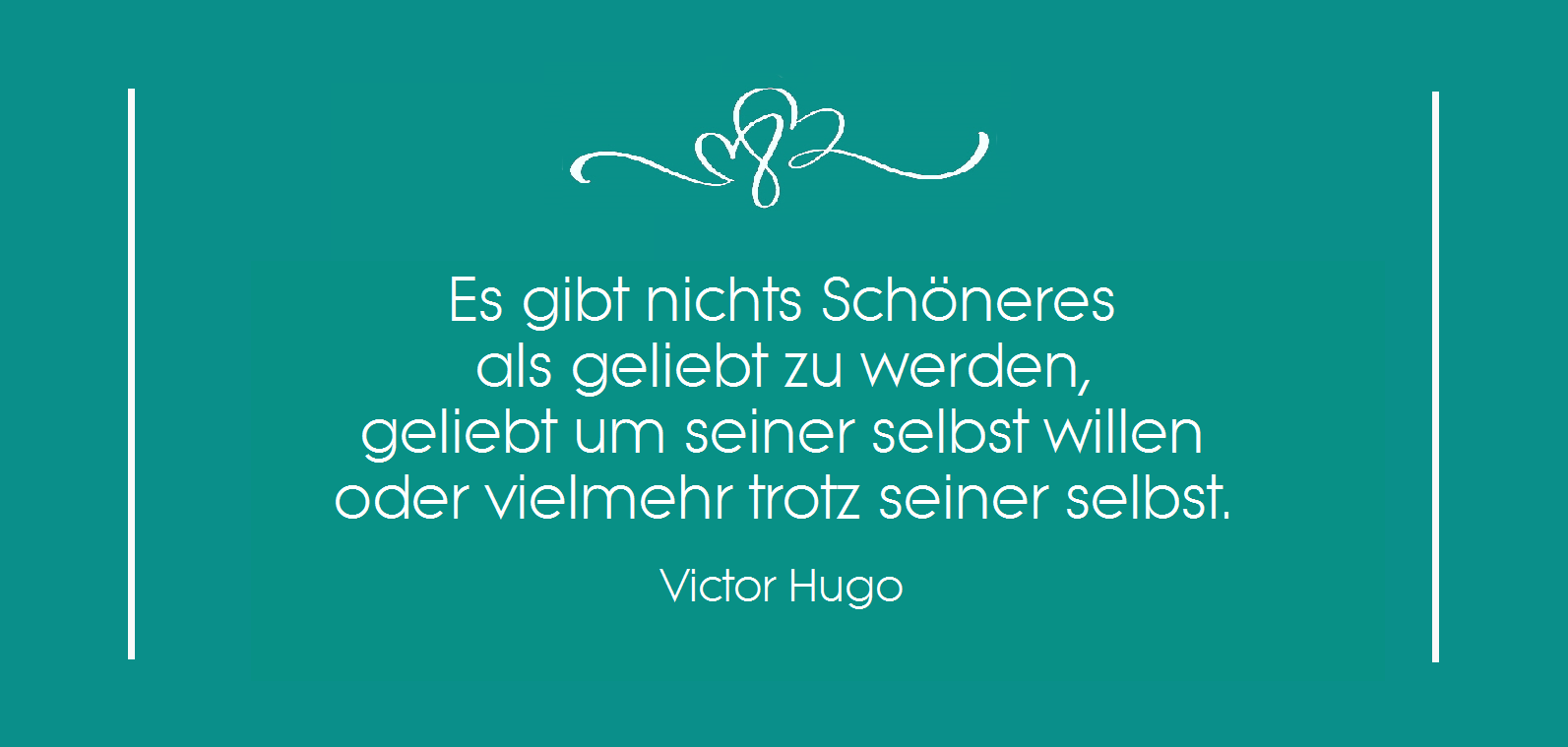
Ich wünsche Euch heute
einen wundervollen VALENTINSTAG!
💞
[Rezension] Kerstin Hau – OBACHT!/ mit Illustrationen von Stella Dreis
„Entschuldigung! Dürfte ich bitte vorbei? Vielen Dank!“
Wie oft habe ich diesen Text im Supermarkt schon angebracht, wenn ein anderer Kunde bzw. eine andere Kundin konzentriert etwas im Regal suchte und dabei den Einkaufswagen ungünstig stehen ließ. Und noch nie habe ich auf meine Bitte eine negative Reaktion erhalten. Doch im Gegenzug, wenn ich konzentriert etwas im Regal suchte, wurde mir schon oft ein Einkaufswagen in die Hacken gerammt, oder ich wurde rüde zur Seite gedrängt – ohne ein Wort. Die Grundregeln eines respektvollen Umgangs scheinen bei einigen Mitmenschen – unabhängig vom Alter – nur noch wenig bekannt zu sein. Dabei ist es doch so einfach: Eine höfliche Ansprache und ein freundliches Lächeln – mehr braucht es nicht!
Aber das Einfache scheint häufig schon ein Zuviel zu sein. Wir müssen wieder lernen, dass ein Miteinandersprechen nicht nur gewünscht sondern auch gewollt ist. Sonst leben wir irgendwann in einer Welt, wo uns allen hin und wieder wunde Hacken quälen. Zumal „die Kleinen“ es nur lernen, wenn wir „Großen“ es ihnen vorleben?
„Sprecht miteinander!“ lautet die Devise, denn wer nicht miteinander spricht, erzeugt nur negative Gefühle und schlechte Gedanken und macht sich das Leben unnötig kompliziert. Ein respektvolles Miteinandersprechen ist der Schlüssel für eine gelungene Kommunikation, fördert das Verständnis und löst Konflikte.
Oh nein, vor der Stadt liegt ein riesiges Tier! Es versperrt den Weg. Eieiei, tönt der Wompf. Oje, stöhnt die Timpe-Ma. Da muss etwas gemacht werden! Und dann machen sie etwas. Sie decken das Tier zu, bauen eine Brücke drüber und eine Straße drum herum. Problem erkannt, Problem gebannt! Nur das Mienchen schüttelt den Kopf, ihm gefällt das gar nicht. Aber wer hört schon auf Mienchen? Da nimmt es sich ein Herz und spricht das Tier einfach an…
(Inhaltsangabe der Homepage des Verlages entnommen!)
Jaja, „die Kleinen“, sie werden so oft unterschätzt. Dabei haben sie manches Mal genau die richtigen Ideen und sehen das Naheliegende häufig deutlicher als wir „Großen“. Vielleicht hatte Kerstin Hau da ähnliche Gedanken wie ich, als sie sich die Handlung zu dieser reizenden Geschichte erdachte. Denn auch in OBACHT! denkt die Obrigkeit, bestehend aus den vermeintlich Klugen, viel zu umständlich, dafür wenig vorausschauend, was schlussendlich zu keinem Erfolg führt. Dafür wird Mienchen gerne überhört, übersehen und übergangen. Zum Glück besitzt diese plietsche Kleine genügend Selbstbewusstsein sowie Durchhaltevermögen, um diese Situation zu meistern. Denn Mienchen weiß, dass das Fremde weniger bedrohlich wirkt, wenn man es besser kennenlernt. So überwindet sie ihre Zurückhaltung vor dem großen, fremden Tier und spricht es höfflich an. Und siehe da: Das große, fremde Tier, das anfangs sooo bedrohlich wirkte, schaut nun freundlich lächelnd drein, und sie finden gemeinsam eine einvernehmliche Lösung.
Stella Dreis steuerte die entzückenden Illustrationen zu dieser kleinen aber weisen Geschichte bei. Sie kleidete die Bilder in schwarz-weiße Nuancen, in denen ein sattes Orange herrliche Akzente setzt und die Aufmerksamkeit des Betrachtenden auf wichtige wie witzige Details lenkt. Dabei schuf sie eine wunderbar wilde Bande aus höchst unterschiedlichen Charakteren – jede Figur so herrlich einzigartig und mit unverkennbaren Merkmalen. Da verspürte ich eine immense Freude beim aufmerksamen Betrachten jedes Bildes, um herauszufinden, wo welche Figur wieder in Erscheinung tritt.
Dies ist eines dieser wundervoll leisen Bilderbücher, das mit ganz viel Charme und einer noblen Schlichtheit eine riesengroße Wirkung erzielt: Es macht Mut, die eigenen Ressentiments zu überwinden, und ist ein Plädoyer für eine wertschätzende Kommunikation.
erschienen bei NordSüd / ISBN: 978-3314107344
Ich danke dem Verlag herzlich für das zur Verfügung gestellte Leseexemplar!
IN·TER·MEZ·ZO…